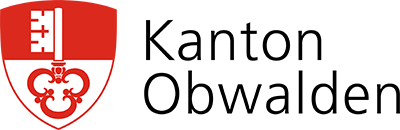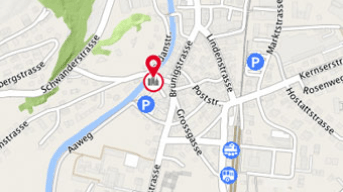Wenn die Wogen steigen: Über den Umgang mit Hochwasser in der Geschichte Obwaldens
von Eveline Szarka, 17. Juni 2025
Im August 2025 jährt sich das Katastrophen-Hochwasser, das auch im Kanton Obwalden verheerende Schäden verursachte, zum 20. Mal. Zu diesem Anlass werfen wir einzelne Schlaglichter auf die lange und vielfältige Geschichte der Hochwasserbewältigung im Kanton Obwalden.
Mit nur 491 Quadratkilometern ist Obwalden einer der kleineren Kantone der Schweiz. Auf dieser relativ kleinen Fläche befinden sich nicht nur fünf grössere sowie mehrere kleine Seen, sondern auch zahlreiche Wildbäche, die sich bei Unwetter zu reissenden Strömen verwandeln und beträchtliche Schäden verursachen können. Es verwundert deshalb nicht, dass die Geschichte Obwaldens und diejenige der Hochwasserbewältigung eng miteinander verflochten sind. Während beim Umgang mit Hochwasser vor mehreren hundert Jahren auch übernatürliche Erklärungsmuster zum Tragen kamen, offenbaren die letzten beiden Jahrhunderte ein stetiges Ringen zwischen Mensch, Natur und Technik. Parallel dazu entwickelten sich aber auch tiefergehende Fragen zur Schadensfinanzierung.
Beten und Bestrafen: Bruder Klaus als Retter in der Not und die Giswiler Hexenverfolgungen
In der Zeit vor 1800 waren die technischen Möglichkeiten zur Eindämmung der Hochwassergefahr beschränkt. Zuflucht fanden die Betroffenen oft im Glauben. Im Zuge der Heiligsprechung von Niklaus von Flüe (1417-1487) bezeugte der Alpnacher Wirt Kaspar Imfeld im Jahr 1625 die Wundertätigkeit des Schweizer Schutzpatrons: Wenige Wochen zuvor ist die (Grosse oder Kleine) Schliere nach anhaltenden Regenfällen aus ihrem Bett gebrochen. Auf dem Nachhauseweg ist Imfeld in den rauschenden Wildbach gefallen, wobei er sich im Gemüte sofort hilfesuchend an Bruder Klaus wandte. So konnte er sich zwar eine Zeitlang mithilfe eines Holzstücks über Wasser halten, wurde aber bald von gewaltigem Geschiebe eingeholt und mitgerissen. Nach einem zweiten Hilferuf an Bruder Klaus blieb er kurz vor Abend in der Nähe des Ufers im Wasser stecken. Aus Angst, in der Nacht zu erfrieren, erbat er den späteren Schutzheiligen des Kantons Obwalden zum dritten Mal inbrünstig um Hilfe und Beistand. Just in diesem Moment konnte er einen im Wasser treibenden Stock ergreifen, mit dem er sich schwer verletzt an das Ufer rettete (Obwaldner Volksfreund, 16.09.1903).
In Zeiten grosser Not bot der Glaube Halt – doch mitunter führte er auch ins Verderben. Am 13. Juli 1629 trat die Giswiler Laui nach einem schweren Unwetter über die Ufer und setzte die Kirche in Giswil unter Wasser. Für den Pfarrer Niklaus Wanner stand ausser Frage, dass die Fluten von Hexen gegen das Haus Gottes getrieben worden waren, um die Altarsakramente zu entheiligen (Degelo 2013, S. 12). Wie beispielsweise das Gerichtsprotokoll zum Fall der Giswilerin Maria Enz zeigt, wurde ihr neben dem Besuch des Hexensabbats und Schadenszauberei an Menschen vorgeworfen, "dass sy die Lauwi zuo Gysswill ouch massen helffen antriben" (A.03.9.1). Gemäss den Ratsprotokollen desselben Jahres wurde sie – wie noch 32 weitere Personen in diesem Jahr – als "Unholdin" verurteilt und hingerichtet (02.RP.0011).
Beschützen und Bremsen: Wuhren, Talsperren und Schutzwälder
Bereits vor den Zeiten der Hexenverfolgungen versuchte man bei Hochwasser mithilfe von Wuhren Schaden an Leib und Gut abzuwenden; eine klare Reglementierung fand jedoch erst ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts statt. Der Bau, der Unterhalt und die Reparatur von Verbauungen waren mit hohen Kosten verbunden, sodass es zunehmend wichtig wurde, klar zu definieren, wer eigentlich für den Hochwasserschutz zuständig war und wer sich in welchem Umfang an den baulichen Massnahmen beteiligen sollte. Der Kanton erliess deshalb am 9. April 1877 das Gesetz über Wasserbaupolizei, Wasserrechte und Gewässerkorrektion (T.02.02.4.203), in dem er festlegte, dass jegliche Verbauungen, Korrektionen, Kanalisationen oder andere Massnahmen, die sich auf den Wasserstand und -lauf sowie auf den Hochwasserschutz bezogen, einer vorgängigen Bewilligung des Regierungsrates bedürfen. Für die Verbauung eines Wildbachs und deren Unterhalt musste fortan eine Wuhrgenossenschaft gegründet werden.
Eine andere Möglichkeit bestand darin, die Wassermassen mithilfe von Schutzwaldungen in Schach zu halten. Nach schweizweiten Überschwemmungen und Murgängen wurde am 24. März 1876 mit dem Bundesgesetz betreffend die Oberaufsicht des Bundes über die Forstpolizei im Hochgebirge das erste schweizerische Umweltschutzgesetz erlassen, da fortan sämtliche Holzschläge wieder aufgeforstet werden mussten (E.0025.09). Dieses Gesetz bezog sich unter anderem explizit auf den Kanton Unterwalden (ob und nid dem Wald) und definierte zum ersten Mal, was unter einem Schutzwald zu verstehen ist. Wälder, die unter anderem an Bach- oder Flussufern dem Schutz vor Überschwemmung dienten, sollten binnen einer Zweijahresfrist als Schutzwälder ausgeschieden und unter die Oberaufsicht des Bundes gestellt werden. Sämtliche Rodungen von Schutzwäldern selbst oder solchen, die den Bestand von Schutzwäldern gefährden, wurden fortan untersagt. Am 24. November 1876 erliess der Obwaldner Kantonsrat die entsprechende Kantonale Vollziehungsverordnung (T.02.02.4.243). Gemäss Art. 57 konnte der Regierungsrat nun verlangen, dass bestimmte Grundstücke mit Schutzwaldungen aufgeforstet werden.
In den 1870er Jahren wurden demnach wichtige Schutzmassnahmen gegen Hochwasser auf kantonaler Ebene verankert und reglementiert, welche die allgemeine Gefahr deutlich verringerten. Allerdings boten diese keinen hundertprozentigen Schutz vor den tosenden Wassermassen. Die aus Steinen errichteten Wuhren hielten dem Geschiebe gerade bei starken Unwettern nicht immer stand. In einem Bericht aus dem Jahr 1874 heisst es beispielsweise, dass die Wuhren an der Laui oder der Grossen Melchaa nach einem Wolkenbruch entweder schwer beschädigt oder ganz weggespült worden seien (Obwaldner Volksfreund, 08.08.1874). Auch das Hochwasser im Jahr 1902 beschädigte die Steinwuhr unterhalb der Strassenbrücke bei der Grossen Schliere stark.
Ähnlich verhielt es sich auch mit den Talsperren. Gemäss einem Bericht im Obwaldner Volksfreund aus dem Jahr 1902 seien im Lauibett nach dem Unwetter ganze zehn Talsperren spurlos verschwunden. Das traurige Fazit: Verbauungen von über CHF 250'000 seien trotz ihrer "soliden Konstruktion" in einem Augenblick zerstört worden und es sei unklar, ob eine weitere Investition in Verbauungen überhaupt sinnvoll sei. In einem resignierten Ton heisst es weiter: "Gewalt geht leider nicht nur im kleinen Kreislauf des menschlichen Lebens vor Recht, auch im riesigen Walten der Natur gilt dieser Grundsatz, und beim Betrachten des riesigen Trümmerfeldes im Lauibach bekommt man den unauslöschlichen Eindruck, dass auch menschlicher Technik, und menschlichem Können eine unüberschreitbare Grenze gesteckt sei und dass die Naturkräfte sich nicht ohne weiteres den Zügel anlegen lassen." (Obwaldner Volksfreund, 13.08.1902)
Bauen und Bangen: Die Melchaa-Korrektion 1880 und Diskussionen um eine Tieferlegung des Sarnersees
Neue Hoffnungen liessen grössere bauliche Massnahmen aufkeimen. Das bis dahin grösste Unterfangen, die Naturkräfte zu bändigen, stellte die Melchaa-Korrektion 1880 dar. Schon Anfang der 1850er Jahre beauftragte die Obwaldner Regierung den Ingenieur Franz Xaver Schwyzer (1812-1893) damit, ein Gutachten zur Hochwasserproblematik auszuarbeiten. Schwyzer empfahl neben einer Tieferlegung der Sarneraa die Verbreiterung des Seeausflusses. 1867 unterbreitete der spätere Kantonsingenieur Kaspar Diethelm (1817-1901) den Vorschlag, die Grosse Melchaa in den Sarnersee umzuleiten und die Sarneraa vom Seeausfluss bis zur Kernmatt zu kanalisieren. Es vergingen erneut Jahre; erst durch ein weiteres verheerendes Hochwasser im Jahr 1873 erhielt das Projekt neuen Aufwind. Schliesslich erfolgte im Frühjahr 1879 unter der Leitung Diethelms der Spatenstich. Nach 15 Monaten Bauzeit floss die Grosse Melchaa am 9. Juni 1880 zum ersten Mal durch den 1.23 km langen Kanal in den Sarnersee (Müller 1996, S. 205-207). Mit der Korrektion verbunden war zudem eine Abtiefung und streckenweise Kanalisierung der Sarneraa sowie eine Verschiebung der Mündung der Grossen Schliere, die bis 1883 realisiert wurden (Vischer 2006, S. 507). Noch vor Abschluss des Projektes diskutierte der Kantonsrat am 1. Oktober 1881 eine mögliche Tieferlegung des Sarnersees; man verfolgte dieses Vorhaben jedoch nicht weiter (KRP.0003).
Zwar wurde die unmittelbare Hochwassergefahr bei der Sarneraa vermindert, allerdings trat als Folge der Sarnersee häufig über seine Ufer; so bereits 1881 und 1882. Dies verursachte nicht nur Schäden an den Häusern, sondern legte teilweise den alltäglichen Betrieb und die Lebensmittelversorgung zahlreicher Institutionen lahm. In den Küchen des Konviktes, des Waisenhauses und des Spitals konnte nicht mehr gekocht werden. Im Obwaldnerhof habe man gar Speisen von Auswärts besorgen müssen, so ein Bericht im Obwaldner Volksfreund. Als besonders besorgniserregend galt die Feuchtigkeit in den Häusern, weshalb die Ärzte häufiges Lüften anordneten. Man verstehe es, so der Bericht weiter, dass die Sarner es kaum erwarten könnten, bis die Bauarbeiten "vollständig genügend, unterlässlicherweise reguliert sein" würden (Obwaldner Volksfreund, 10.09.1881). Eine Optimierung des Seeausflusses wurde im Jahr 1883 zwar vorgenommen, gemäss den Anstössern jedoch in unzureichender Weise. Aus diesem Grund forderten sie im Regierungsrat eine weitere Abtiefung der Sarneraa bei der Flussmündung, die aus Kostengründen jedoch unterblieb (Vischer 2006, S. 507). Im Herbst 1897 reichten die Seeanstösser Arnold Hess und Franz Josef Ettlin beim Regierungsrat ein Gesuch mit der Bitte um Korrektion des Seeausflusses ein. Die Arbeiten in den 1880er Jahren seien ungenügend ausgeführt worden und die letzten Jahre hätten gezeigt, dass der durchschnittliche Wasserpegel durch den Zufluss der Melchaa erheblich gestiegen sei. Bei Hochwasser werde der "mangelnde Ablauf geradezu zu einer Calamität". Eine Antwort erhielten die Gesuchsteller nicht; Anfang 1899 monierte Ettlins Anwalt bei der Obwaldner Regierung die fehlende Rückmeldung und fügte hinzu, dass sein Mandant seine Zahlungen an die Wuhrgenossenschaft Sarnen aussetze, bis seinem Begehren entsprochen werde (D.03.0439.1).
Nachdem es zu Beginn des 20. Jahrhunderts gleich mehrmals zu Überschwemmungen kam, unterbreitete der Holzhändler Karl von Moos dem Kantonsrat am 12. November 1903 gemeinsam mit 135 Mitunterzeichneten ein Initiativ-Begehren zur Tieferlegung des Sarnersees um 1 Meter (D.03.0439.1). Im März 1904 wurde das Begehren zwar besprochen, allerdings wieder zur Seite gelegt. Aufgrund einer weiteren Überschwemmung zwei Jahre später lautet es in einem Leserbrief an den Obwaldner Volksfreund, vielleicht verfasst von Karl von Moos selbst: "Der diesjährige Hochwasserstand des Sarnersee's [sic!] weckt in jedem Uferanstößer das Gefühl, daß es doch bald an der Zeit wäre, für einen genügenden Abfluß des Sees zu sorgen. Kommt es doch beinahe alle Jahre vor, daß die Seeanstößer durch Hochwasser Schaden leiden und gerade das Einleiten der Melcha verursacht nicht am wenigsten diesen schädigenden Hochstand des Sees." (Obwaldner Volksfreund, 06.06.1906). Die Petition landete im November desselben Jahres erneut auf dem Tisch des Kantonsrates. Eine Tieferlegung des Sarnersees wurde diesmal jedoch definitiv abgelehnt und ad acta gelegt – das Problem bestand jedoch weiterhin. Schon wenige Jahre später, am 14. und 15. Juni 1910 kam es schweizweit zu einer Hochwasserkatastrophe, die besonders Engelberg, Lungern und das Melchtal mit voller Härte traf. Gemäss einem Augenzeugenbericht soll die Melchaa zu einem mächtigen Strom angeschwollen sein: "Der Kanal bis an den See hielt stand, ist aber sehr stark beschädigt. […] Der Melchaa-Kanal hat eine harte Probe bestanden." Auch einen Todesfall gab es zu betrauern: Ein Mann ertrank am Ufer des ansteigenden Sarnersees (Obwaldner Volksfreund, 15.06.1910). Wohl aufgrund der Ereignisse im Jahr 1910 setzte sich von Moos mit einer Schrift erneut (und wieder vergeblich) für sein Initiativ-Begehren ein (von Moos 1911).
Beistehen und Bezahlen: "Liebesgaben", Fonds und Versicherungen
Neben den Schutz- und Baumassnahmen zur Regulierung des Wasserflusses warfen Überschwemmungen die Obwaldner Bevölkerung immer auf die Frage nach der finanziellen Schadensbewältigung zurück. Gerade für ärmere Leute stellte ein Hochwasser schnell eine existentielle Bedrohung dar. Nach dem Hochwasser im August 1902 schrieb der Gemeinderat Giswil an die Regierungsräte, dass insbesondere schlecht bemittelte Personen unter den Schäden zu leiden hätten: "In wenigen Augenbliken [sic!] waren die Betroffenen um die Früchte jahrelanger Arbeit und aufgelegter Entbehrungen, gebracht. Zu diesem materiell an und für sich schon grossen Unglück, gesellt sich nun noch ein zweites Unglück, indem die Beschädigten muth- und thatlos dastehen und mit Stumpfsinn der Zukunft entgegensehen." (D.03.0735.02) Deshalb waren die Obwaldnerinnen und Obwaldner auf die Solidarität ihrer Mitmenschen angewiesen. 1902 wurden Hauskollekten durchgeführt, bei dem ein Betrag von CHF 7'953.63 zusammenkam. Gleichzeitig gingen Spenden in der Höhe von insgesamt CHF 3'386.63 aus der ganzen Schweiz ein (D.03.0735.02). Wie die im Staatsarchiv Obwalden erhaltenen Spenden-Coupons belegen, sammelte der Bülacher Pfarrer nach einem Aufruf in der Bülacher Wochenzeitung CHF 136.79, während nach einem Appell in den Basler Nachrichten CHF 276.84 an Spenden eingingen.
Nach der Hochwasserkatastrophe im Jahr 1910 kamen bei Hauskollekten in Obwalden CHF 9'657.70 zusammen, die der Kanton an den Schweizerischen Fonds für nicht versicherbare Elementarschäden übermittelte. Gleichzeitig reichte man Listen der Geschädigten ein, wobei die Vermögens- und Familienverhältnisse berücksichtigt wurden. Nach einer eingehenden Schadensschätzung flossen CHF 26'150 an die 149 Geschädigten zurück, die in vier verschiedene Vermögensklassen eingeteilt wurden. (D.03.0735.03). Der Fonds war nicht nur auf Kollekten unmittelbar nach Naturereignissen angewiesen, sondern auf wiederkehrende Zahlungen. 1911 bat der Fonds den Kanton Obwalden um einen jährlichen Beitrag, der zuerst CHF 50 betrug und 1930 auf CHF 500 erhöht wurde (D.03.0732). Die Beträge reichten bei Weitem nicht, um die gesamten Hochwasserschäden zu finanzieren. 1910 deckten die Liebesgaben nur rund ein Drittel des Gesamtschadens. Auch bei Überschwemmungen im Sommer 1931 reichten die Spenden und Beträge des Schweizerischen Fonds für nicht versicherbare Elementarschäden nur für einen Drittel der Gesamtschäden in der Höhe von rund CHF 160'000 aus (D.03.0735.02). Aus diesem Grund wurden Forderungen nach einer kantonalen Lösung laut, denn Obwalden verfügte – wie 17 weitere Kantone – über keine staatlichen oder privaten Fonds für Elementarschäden. Schon 1926 wurde eine Motion zur Schaffung eines kantonalen Hilfsfonds eingereicht, deren Gesetzesentwürfe Ende der 1920er und Anfang der 1930er Jahre immer wieder im Kantonsrat diskutiert wurden. Am 1. Februar 1933 hielt die kantonsrätliche Kommission in einem Schreiben fest, dass die Angelegenheit vorerst zu den Akten gelegt werde, da sie mit einer Gesetzesvorlage über die Schaffung einer Viehversicherung kollidiere (D.03.0734).
Zur Diskussion stand auch eine Hochwasserversicherung. Gemäss einem Brief des Schweizerischen Fonds für nicht versicherbare Elementarschäden an den Kanton Obwalden 1922 heisst es, dass sich von den 96 Schweizer Versicherungsgesellschaften nur gerade drei mit Wasserschäden befassten und nur eine auf Hochwasserschäden spezialisiere (D.03.0732). Bereits 1911 publizierte der Ingenieur Arnold Härry eine Schrift, in der er sich für die Gründung einer eidgenössischen Hochwasserversicherung ausspricht (Härry 1911). Darin hält er fest, dass es fatal sei, sich lediglich auf die Liebesgaben zu verlassen, da die "öffentliche Mildtätigkeit mit der Zeit abflaut". Hochwasserkatastrophen hätten sich in den letzten Jahren nämlich "in auffallender Weise gehäuft" und vielleicht stehe man "in einer Periode vermehrter Niederschläge". Der Anstoss für die Versicherung kam vom Schweizerischen Wasserwirtschaftsverband, der die Obwaldner Kantonsregierung im Jahr 1911 um statistische Angaben zu vergangenen Schadensereignissen bat. Diese kam der Aufforderung aber nicht nach, mit dem Argument, dass es schlichtweg unmöglich sei, an zuverlässige Hochwasserdaten zu gelangen (D.03.0733).
Im Rahmen eines weiteren Vorstosses in den 1930er Jahren entstand ein Bericht über Elementarschäden und Versicherung im Kanton Obwalden, die eine Chronik aus den Jahren 1851-1933 enthält. Die Autoren stützen sich dabei penibel auf Dossiers des Staatsarchivs, Forstberichte sowie das Amtsblatt ab. Für die Untersuchungsperiode verzeichneten sie insgesamt 28 Überschwemmungsereignisse, allein 11 davon fielen in die Zeit von 1920 bis 1933. Die Chronik zeige, so das Fazit, dass die häufigen Überschwemmungen ein besonderes Charakteristikum des Kantons Obwalden darstellen würden. Die Autoren sahen der Zukunft jedoch vorsichtig optimistisch entgegen: Die zahlreichen Verbauungen und Aufforstungen hätten die Hochwassergefahr erheblich eingedämmt. Sie werde durch die derzeitigen Arbeiten in Zukunft weiter vermindert, auch wenn sicherlich in Zukunft mit grossen Wasserschäden zu rechnen sei (Lanz-Stauffer / Rommel 1936, S. 342f.). Die Technik des Hochwasserschutzes hat tatsächlich bemerkenswerte Fortschritte gemacht. Dennoch, so Arnold Ming im Heimatbuch Obwalden, gehöre das ständige Bangen um „Hab und Gut“ nach wie vor zum Alltag eines Berglers – ebenso wie die Hinwendung zu Gott und der inständige Ruf zu den Heiligen. Bei einem heraufziehenden Gewitter frage er sich denn stets: "Ist unser Heimetli bis am Morgen mit Stein und Geröll überschüttet oder gar ein Teil davon ins wilde Bachtobel hinuntergerutscht? Es drängt ihn an zu beten: 'Lieber Landesvater, Bruder Klaus, halte Deine starke, schützende Hand über Grund und Boden und hilf mit die Gefahr bannen!'" (Ming 1952, S. 357).
Literatur:
- Degelo, Ludwig: Loiwi. Giswil 1629: Der Untergang der alten Kirche, die anschliessende Hexenverfolgung und der Fall der Familie Bergmann, Giswil 2013.
- Härry, Arnold: Versicherung gegen Hochwasserschäden. Ergebnisse der Enquête des Schweizerischen Wasserwirtschaftsverbandes, o.O. 1911 (Separatabdruck aus der Schweizerischen Wasserwirtschaft 3, Nr. 19-21).
- Lanz-Stauffer, Hermann / Rommel, Curt: Elementarschäden und Versicherung. Kanton Obwalden, Bern 1936 (Sonderdruck aus der Studie des Rückversicherungsverbandes kantonal-schweizerischer Feuerversicherungsanstalten zur Förderung der Elementarschadenversicherung), S. 305-343.
- Ming, Arnold: Von wilden Wassern. In: Obwaldner Heimatbuch, hrsg. im Auftrage des Kantonsrates vom Erziehungsrate des Standes Obwalden, Basel / Engelberg 1953, S. 350-357.
- Moos, Karl von: Die Tieferlegung des Sarnersees, Sarnen 1911.
- Müller, Thomas: Sarnen, Bern 1996 (Separatdruck aus INSA Inventar der neueren Schweizer Architektur 1850-1920 8), S. 185-266.
- Vischer, Daniel L.: 125 Jahre Umleitung der Grossen Melchaa in den Sarnersee, in: Geomatik Schweiz 104/9 (2006), S. 506-509.
Zitiervorschlag:
Szarka, Eveline: "Wenn die Wogen steigen: Über den Umgang mit Hochwasser in der Geschichte Obwaldens". In: Archivfenster des Staatsarchivs Obwalden, 17.06.2025. Online: https://www.ow.themenalle/thema/6856, konsultiert am TT.MM.JJJJ.
Zugehörige Objekte
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Staatsarchiv | +41 41 666 62 14 | staatsarchiv@ow.ch |