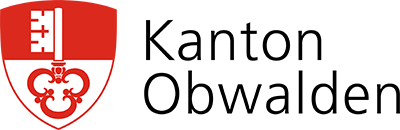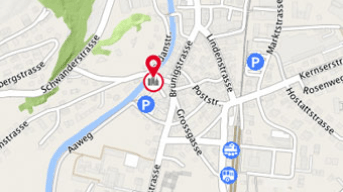Licht und Wasser: Der Bau des Lungererseewerks in Fotografie und Film
von Carla Roth, 27. März 2025
Vor rund 100 Jahren begannen die Centralschweizerischen Kraftwerke mit dem Bau des Lungererseewerks. Ein neu digitalisierter Foto- und Filmbestand im Staatsarchiv Obwalden wirft nun Licht auf das monumentale Bauprojekt und auf die bewegte Geschichte des Lungerersees.
Ein Mann steht mit überkreuzten Beinen auf einem schmalen Felsvorsprung und bearbeitet den steilen Fels neben seinen Füssen mit einem Bohrer. Provisorische Treppen und Bahngleise führen Menschen und Material in unwegsames Gelände. Mit Holzbalken wird der Eingang eines Stollens abgestützt. Wie eine Mondlandschaft breitet sich ein leeres Seebecken vor den Augen der Betrachtenden aus. Riesige Druckrohr- und Turbinenelemente schweben über dem Bahnhof Giswil und werden auf Pferde- und Autotransporte umgeladen – und spätestens an dieser Stelle kann man erahnen, welcher monumentale Bau in den alten Glasplattenfotografien gerade im Entstehen begriffen ist: das Lungererseewerk. Das Staatsarchiv hat diesen aussergewöhnlichen Foto- und Filmbestand in den letzten Monaten digitalisiert und stellt in diesem Archivfenster einige besondere Stücke daraus vor.
Absenkung, Aufstauung, Ausbau: Die bewegte Geschichte von Lungerersee und Lungererseewerk
Im September 1918 reichten die Centralschweizerischen Kraftwerke (CKW) bei der Obwaldner Regierung ein Projekt für den Bau einer "Wasserkraftanlage Lungerersee" ein. Der Zeitpunkt war günstig: Während des ersten Weltkrieges, der gerade zu Ende ging, waren die Lücken in der Energieversorgung und die Abhängigkeit von Energieträgern aus dem Ausland besonders deutlich geworden. Beide Probleme sollten nun durch den Ausbau der inländischen Stromproduktion angegangen werden. Das Projekt der CKW, das kostengünstigen lokalen Strom versprach, fand bei der Obwaldner Regierung entsprechend Gehör: 1919 erteilte der Kanton den CKW eine Konzession für den Bau und Betrieb eines Wasserkraftwerkes am Lungerersee.
In Lungern hingegen formierte sich rasch massiver Widerstand gegen das Projekt: Nicht einmal 100 Jahre war es her, seit der Lungerersee 1836 nach jahrelangen Verzögerungen und mit grossem finanziellen Aufwand abgesenkt worden war, um zusätzliches Kulturland für die Lungerer Bauern zu gewinnen – und nun sollte ebendieses Land bereits wieder aufgegeben und der See zugunsten eines Wasserkraftwerks aufgestaut werden. Bis vor den Bundesrat zogen die Gegner des Projektes ihre Beschwerde – aber als dieser sie Ende März 1921 endgültig abwies, hatten die Bauarbeiten am Lungerersee bereits begonnen. Innerhalb weniger Monate wurde der 1836 erbaute Stollen, der ursprünglich der Absenkung des Sees gedient hatte, zu einem Druckstollen umgebaut und mit einem Druckrohr ergänzt, welches das Wasser des Lungerersees über den steilen Hang hinab in die neu erbaute Kraftwerkzentrale Unteraa in Giswil leitete. Bereits im November 1921 konnte das Lungererseewerk in Betrieb genommen werden. Damit war allerdings nur die erste Bauetappe abgeschlossen: Allein bis 1934 erfuhr das Kraftwerk drei Erweiterungen, welche die durchschnittliche Jahresproduktion des Kraftwerks sukzessive von ca. 17'000'000 auf 90'000'000 Kilowattstunden erhöhten (Abb. 6).
Der Kraftwerkbau im Fokus
Das Lungererseewerk war nicht nur das erste grosse Wasserkraftprojekt im Kanton Obwalden, sondern wohl auch das erste, dessen Bau systematisch fotografisch dokumentiert wurde: Mehrere Hundert Glasplattennegative und 3.5 Stunden Filmmaterial sind allein aus den vier Bauetappen von 1921 bis 1934 erhalten geblieben. In den Bildern und Filmen des Kraftwerkbaus wird der Kontrast zwischen Tradition und Moderne, welcher die frühen Wasserkraftprojekte nicht nur in Obwalden charakterisierte, besonders gut greifbar: Die für den Bau benötigten Maschinen und Bauteile wurden teils noch auf Pferdewagen transportiert; die Umsetzung des technisch hochkomplexen Projektes erfolgte über weite Strecken in Handarbeit. Letztere wurde von Hunderten Arbeitern geleistet - 1932 waren es 440, darunter 270 mehrheitlich italienische Mineure und Maurer (Obwaldner Volksfreund, 13.04.1932) - die in der schriftlichen Überlieferung zum Kraftwerkbau fast völlig fehlen und die nun in den Bildern des Kraftwerkbaus erstmals sichtbar werden.
Erster Ausbau (1921)
Im Zuge des ersten Ausbaus wurde der Lungerersee um 16 m aufgestaut, der alte Stollen von 1836 zu einem Druckstollen umgebaut und eine Druckleitung installiert, die das Wasser vom Ende des Stollens den Berg hinab in die neu erbaute Zentrale Unteraa (später Zentrale Giswil) leitete. Ein Unterwasserkanal führte das genutzte Wasser von dort aus zurück in die Giswileraa.
Zweiter Ausbau (1923-1924)
Im Zuge des zweiten Ausbaus wurde eine zweite Druckleitung erstellt und eine weitere Turbine in der Zentrale Unteraa installiert. Gleichzeitig erfolgte eine Vergrösserung des Unterwasserkanals und eine Korrektion der Giswileraa.
Dritter Ausbau (1925-1926)
Im Zuge des dritten Ausbaus wurde die Kleine Melchaa gefasst und über einen 3 km langen Stollen sowie eine Absturzleitung bei Kaiserstuhl dem Lungerersee zugeführt. Gleichzeitung wurde ein Schieberturm erbaut und die Badeanstalt am Lungerersee versetzt, die aufgrund der Stauung des Sees nicht mehr am früheren Standort am Tschorrenrank verbleiben konnte.
Vierter Ausbau (1930-1934)
Im Zentrum des umfangreichsten vierten Ausbaus stand der Bau des 6.5 km langen Melchaastollens, über den nun Wasser von der Grossen Melchaa in die Kleine Melchaa und von dort in den Lungerersee geleitet werden konnte. Gleichzeitig erfolgte der Bau eines zweiten Kraftwerks bei Kaiserstuhl und eines weiteren Druckstollens sowie eine Vergrösserung der Zentrale in Giswil.
Erhellende Quellen: Historische Bestände von CKW und EWO im Staatsarchiv Obwalden
60 Jahre lang wurde das Lungererseewerk durch die Centralschweizerischen Kraftwerke betrieben, bis der Kanton nach Ablauf der Konzession 1980 von seinem Rückkaufsrecht Gebrauch machte. Damit ging nicht nur das Lungererseewerk, sondern auch ein Teil des CKW-Archivs an das Elektrizitätswerk Obwalden (EWO) über, dessen historische Bestände sich inzwischen im Staatsarchiv befinden. Letztere enthalten nicht nur die bereits erwähnten Foto- und Filmbestände zum Bau des Lungererseewerks, sondern auch Projektakten und Pläne des Kraftwerkbaus und seiner zahlreichen Erweiterungen, die bis in die 1990er-Jahre reichen – darunter auch solche, die aus ökologischen oder finanziellen Gründen nie umgesetzt wurden. Aber nicht nur für die Geschichte des Lungererseewerks selbst hält der Bestand einiges bereit: Weil das Kraftwerk auf das Wasser des Sees und seiner Zuflüsse angewiesen war, enthält das Archiv etwa detaillierte Daten über Pegelstände, Zu- und Abflussmengen sowie Temperaturen (E.0322.01.14, E.0322.01.30, E.0322.01.71, E.0322.01.26, E.0322.01.15, E.0322.01.66 (04)). Das historische EWO-Archiv wirft damit nicht nur ein Schlaglicht auf die Geschichte der Energiegewinnung in Obwalden, sondern auch auf die Umweltgeschichte des Kantons.
Sind Sie an weiteren Fotografien und Filmausschnitten des Lungererseewerks interessiert? Dann werfen Sie einen Blick in die AV-Mediensammlung des Staatsarchivs auf Zentralgut oder nutzen Sie die Fotosuche im Archivkatalog.
Quellen:
- StAOW E.0322 Elektrizitätswerk Obwalden (EWO): Archiv der Abteilung Produktion
Literatur zum Thema:
- Denzer Naomi: Landnahme am Lungerersee. Mikrogeschichtliche Untersuchungen der Interessen zur Tieferlegung des Lungerersees (1788-1836) als lokales Wasserbauprojekt zum Gewinn von Kulturland. Unveröffentlichte Masterarbeit, Universität Zürich 2024.
- Studach Willi: Der Lungerersee im Brennpunkt von Kraftwerkinteressen. In: Obwaldner Geschichtsblätter 19 (1990), S. 297–320.
- Venetz Adrian: Ein Stausee ohne Rückhalt. In: Aktuell, 27.10.2022, Online: https://www.yumpu.com/de/document/fullscreen/67338686/aktuell-obwalden-kw-43-27-oktober-2022.
- Wiesmann, E.: Vom Bau des Melchaastollens des Lungernsee-Kraftwerkes. In: Schweizerische Baumeisterzeitung 47-49 (1931).
- Das Lungererseewerk der Centralschweizerischen Kraftwerke in Luzern. In: Führer durch die schweizerische Wasser- und Elektrizitätswirtschaft, Bd. 2, 3. Ausgabe 1949.
Zitiervorschlag:
Roth, Carla: "Licht und Wasser: Der Bau des Lungererseewerks in Fotografie und Film". In: Archivfenster des Staatsarchivs Obwalden, 27.03.2025. Online: https://www.ow.ch/themenalle/thema/6748, konsultiert am TT.MM.JJJJ.
Zugehörige Objekte
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Staatsarchiv | +41 41 666 62 14 | staatsarchiv@ow.ch |